Stromverteilung
Der Strom und seine Verteilung
Der durchschnittliche Stromverbrauch einer vierköpfigen Familie wird von der Statistik mit ca 3.600 KW/Jahr angegeben. Dabei muss man berücksichtigen, dass Familien in Einfamilienhäusern mit Garten eher mehr Strom verbrauchen, als gleichgroße Familien in Geschoßwohnungen. Es kommt natürlich darauf an, wozu Strom verbraucht wird. Wer noch mit Gas kocht, verbraucht weniger Strom, wer auch mit Strom heizt, braucht erheblich mehr.
Wenn man versucht, den Stromverbrauch eines Mehrparteienhauses, das nicht mit Strom geheizt wird, abzuschätzen, kommt man mit der Formel „Anzahl der Wohnungen mal 3.600 KW“ vermutlich zu einem weit überhöhten Wert. Stadtbewohner verbrauchen eher deutlich weniger, Strom genaue statistische Daten gibt es anschrinend nicht. In den seltensten Fällen bekommt man die Daten über den Stromverbrauch der Bewohner, also bleibt nur übrig, den Gesamtstromverbrauch zu schätzen.
Dabei hilft, wenn man einen Überblick über seine Mitbewohner hat. Wohnen viele Großfamilien oder Wohngemeinschaften im Haus oder stehen Wohnungen leer und in den anderen wohnen vorwiegend Paare und Singles? Wenn einem Stromverbrauch von schätzungsweise 100.000KW einer Solaranlage von etwa 50kWp gegenüber steht, weiß man, dass nur die Hälfte des Strombedarfs von der eigenen Anlage gedeckt werden kann. Das ist nicht gerade viel und reduziert sich noch durch die Tatsache, dass vermutlich nicht immer der gesamte produzierte Strom im Haus verbraucht wird und daher als Überstrom ins Netz eingespeist werden muss.
Auch das Haus selber verbraucht viel Strom, für Gangbeleuchtung, Liftanlagen, zur Steuerung der Heizungsanlage und für die Gemeinschafts-Waschmaschine. Wie hoch der Verbrauch dafür ist, weiß die Hausverwaltung. Da es bei einem durchschnittlichen Mehrparteienhaus sehr unwahrscheinlich ist, dass große Mengen Überstrom anfallen, muß man sich zunächst allerdings auch wenig Gedanken über die Anschaffung eines Speichers machen. Wenn die Anlage mindestens ein Jahr gelaufen ist, kann man besser abschätzen, ob der Einsatz eines Speichers sinnvoll ist.
Glücklicherweise wird die nachträgliche Erweiterung einer Anlage um einen Speicher in Wien gefördert. Den Strom, der nach Abzug des Stroms für das Haus übrigbleibt, kann man jetzt an die Hausparteien „verteilen“.
Da nicht genug für den gesamten Stromverbrauch aller Hausparteien erzeugt werden kann, ist es vielleicht eine sinnvolle Vorgangsweise bei einem solchen Gemeinschaftsprojekt, analog zur Wohnnutzfläche und Eigentumsanteilen zuzuteilen und jeder Hauspartei der Einfachheit halber ein gleichgroßes Kontingent zuzuordnen. Sollte eine Hauspartei weniger verbrauchen, wird ihr natürlich nur der konsumierte Strom verrechnet, für den Rest bekommt sie eine „Gutschrift“, und der übrig gebliebene Strom kann unter den Mitbewohnern verteilt werden, die mehr benötigen. Die Firma, die die Verrechnung übernimmt, hat vielleicht auch noch gute Tipps, wie man die Stromverteilung optimal regeln kann.
Stromverkauf im Haus
Wieviel Stromertrag kann die Solaranlage im Jahr voraussichtlich erzeugen? Wie hoch sind die Betriebskosten im Jahr?
Auch im laufenden Betrieb verursacht eine Solaranlage Kosten (durch die Hausverwaltung als „Betreiber“, Stromabrechnung, Steuerberechnung und -abführung, Wartung und Reparatur, Versicherung). Eventuell will man mit einer „Reparaturreserve“ für allfällige größere Reparaturen vorsorgen und im Vorhinein Geld für Erweiterungen (Speicher) oder Erneuerungen (Wechselrichter) der Anlage zurücklegen. Fallen zusätzlich Kosten für die Anlage an?
Kreditkosten
Wenn der „Investor“, zum Beispiel die Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaft (WEG) die notwendigen Investitionskosten nicht zur Gänze zB aus dem (hoffentlich gut gefüllten) Reparaturfond aufbringen kann, muss ein Kredit aufgenommen werden. Das erzeugt („no na“) zusätzliche Kosten.
Rechenaufgaben
Wenn man den jährlich erwartbaren Stromertrag mit dem Verkaufspreis des Stroms (pro Kilowatt) an die Hausparteien multipliziert, kann man die Einnahmenseite errechnen und sie den Ausgaben gegenüberstellen.
Wenn man die laufenden Kostenvon den Einnahmen abzieht, erhält man den Gewinn.
Dieser wird maßgeblich durch den angenommenen „internen“ Stromverkaufspreis bestimmt (an den Kosten sollte man nicht „herumschrauben“ und sie sich „schön rechnen“). Hier sollte man einen Preis wählen, der irgendwo zwischen dem ortsüblichen Preis des Netzbetreibers und dem für die Hausgemeinschaft (noch) attraktiven Preis liegen sollte.
Für die Wohnungsbesitzer, die ja die „Investitionskosten“ tragen, kann zB ein niedrigerer Preis gelten, als für Mieter, die (verglichen mit dem Marktpreis des Netzanbieters) immerhin die Netzgebühren sparen.
KOMMENTAR
Der „Eigentümer-Preis“ sollte nicht zu niedrig angenommen werden,
denn ohne Gewinn amortisiert sich die Anlage nie.
Der „Mieterpreis“ sollte nicht zu nahe am Marktpreis kalkuliert sein,
wenn man Abnehmer für den eigenen Strom haben will!
[WEITER]
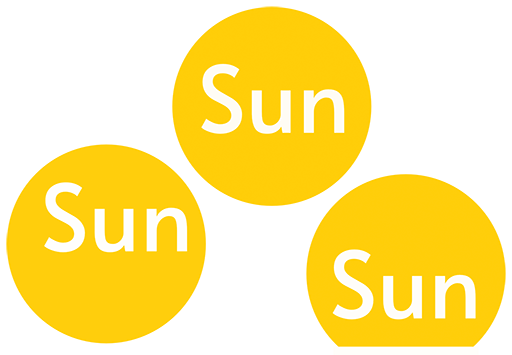
0 Kommentare